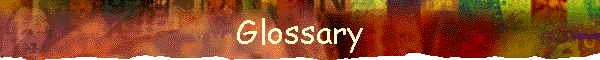|
ALPHABETIC LIST OF TERMS USED
|
FIGURE IN
PUNT et al.-GLOSSARY
|
|
Acetolyse-Resistenz:
Teil bei der Probenaufbereitung (Pollen,
Sporen), bei welchem mithilfe von Essigsäure-Anhydrid
und konz. Schwefelsäure die Zellulosepartikel aus den Präparaten
entfernt werden. Die Pollen bleiben dabei erhalten, denn das Sporopollenin
in ihren Zellwänden ist acetolyse-resistent.
( Probenaufbereitung)
Probenaufbereitung)
|
|
|
Äquatoransicht:
Die Ansicht eines Pollens oder einer Spore, bei welcher die Äquatorebene
gegen den Beobachter gerichtet ist.
( Polansicht)
Polansicht)
|
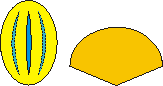
|
|
Analogie, analog:
Ähnlichkeit von Organen, Merkmalen und Verhaltensweisen verschiedener
Arten von Lebewesen, welche nicht auf einer gemeinsamen Abstammung
beruhen, sondern aufgrund von ähnlichen ökologischen Zwängen als
Anpassungen durch natürliche Selektion entstanden sind. Die Analogie
wird der Homologie gegenübergestellt.
( Homologie)
Homologie)
|
|
|
Anulus (pl. Anuli; Anus = Ring):
Eine Pore umgebender, verdickter oder dünnerer
Teil der Exine. (Oft findet man auch Annulus.)
( Margo)
Margo)
|
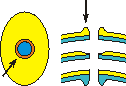
|
|
Apertur (apertus = offen):
Öffnung oder dünnere Region der Exine, meistens
in einem regelmässigen Muster angeordnet. Dient als Austrittsstelle
für den Pollenschlauch. Die A. ist unabhängig vom Exinenmuster.
( Colpus; Porus; Colporus)
Colpus; Porus; Colporus)
|
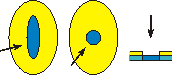
|
|
Arcus (= Bogen; pl. arcus):
Ein lokal verdicktes bogenförmiges Band, welches die
Anuli einiger porater Pollenkörner miteinander
verbindet (e.g. Alnus).
|
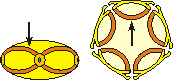
|
|
Areolae (= kleine freie Plätze; sing.
Areola):
Synonym: Frustillae (= abgebrochene kleine Stücke; sing. Frustilla):
Kleine Fläche des Tectums, welches zwei oder
mehrere Columellae bedeckt.
|
 top
top
|
|
Areolat (adj.):
Mit Areolae. (Synonym:
Frustillat)
|
|
|
Baculum (= Stab; pl. Baculi):
Ein freistehendes stäbchenförmiges Element der Exine,
welches länger als 1 Mikrometer und als sein eigener Durchmesser
ist.
( Columellae)
Columellae)
|
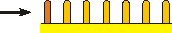
|
|
Baculat (adj.):
Mit Baculi
|
|
|
Bilateral (adj.):
Pollen und Sporen, welche nur eine Symmetrieebene aufweisen.
|
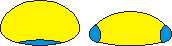
|
|
Bisaccat / Saccat (adj.):
Synonym: vesiculat:
Pollen, die (ein oder) zwei Luftsäcke enthalten. Diese Luftsäcke
dienen der besseren Verbreitung durch den Wind. (e.g. Pinus,
Picea, Abies)
|
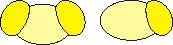
|
|
Clava (Keule; pl. Clavae):
Ein freistehendes keulenförmiges Element der Exine,
welches länger als 1 Mikrometer und als sein eigener Durchmesser
und an der Basis verdickt ist.
|
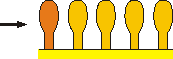
|
|
Clavat (adj.):
Mit Clavae
|
|
|
Colpat (adj.):
Pollenkorn mit einem oder mehreren Colpi.
|
 top
top
|
|
Colporat (adj.):
Pollenkorn mit einem oder mehreren Pori und
Colpi
|
|
|
Colporus (pl. Colpori):
Beide Öffnungstypen (Colpi und Pori)
finden sich in einer Apertur.
|
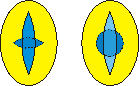
|
|
Colpus (pl. Colpi):
Allgemeine Bezeichnung der Palynologie
für eine Öffnung in der Exine des Pollenkorns,
welche eine längliche Form und zugespitzte Enden hat.
|

|
|
Columellae (= Säulchen; sing. Columella):
Stäbchenförmige Strukturelemente zwischen der Fussschicht
/ Endexine und dem Tectum.
Unterschied zwischen Baculum und
Columella ist, dass ersteres stets ein freistehendes Element
der Skulptur, während das letztere Teil
der Struktur ist.
( Baculum)
Baculum)
|
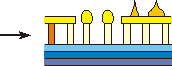
|
|
Dicolpat, dicolporat,
diporat (adj.):
Beschreibt Pollenkörner, welche zwei Colpi,
zwei zusammengesetzte Aperturen oder zwei
Pori aufweisen
|
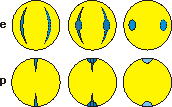
|
|
Diploxylon-Typ:
Bisaccate (vesiculate) Pollen, bei denen
die Luftsäcke gegenüber dem Mittelteil eingeschnürt sind. (e.g.
Pinus sylvestris)
( Haploxylon-Typ)
Haploxylon-Typ)
|
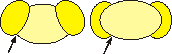
|
|
Diskordantes Muster:
Ein Muster in einem tectaten Pollenkorn,
in welchem die Columellae gegenüber den
Elementen auf dem Tectum versetzt angeordnet
sind.
( Konkordantes Muster)
Konkordantes Muster)
|
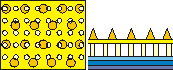
|
|
Dyade:
Allgemeine Bezeichnung für zwei Mikrosporen,
welche als eine Verbreitungseinheit vereint sind. (Ein Dyadenstadium
in der Entwicklung findet sich vor der Tetradenbildung,
während der Meiose.)
( Tetrade; Isodiametrische
Tetrade)
Tetrade; Isodiametrische
Tetrade)
|

|
|
Echinae:
Freistehende stäbchenförmige Elemente der Exine,
welche zugespitzt und länger als 1 Mikrometer sind.
|
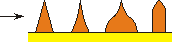
|
|
Echinat (adj.; stachelig):
Mit Echinae
|

|
|
Ectexine:
Der äussere Teil der Exine, welcher durch
Fuchsin rot bis pink gefärbt wird. Die E. enthält das Tectum,
(falls vorhanden), die Columellae und
die Fussschicht.
(Bezeichnung der Zellwände nach deren Färbungseigenschaft.)
( Endexine; siehe auch Sexine)
Endexine; siehe auch Sexine)
|
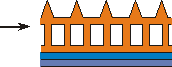
|
|
Endexine:
Der innere Teil der Exine, welcher durch Fuchsin
nicht gefärbt wird. Beinhaltet die sogenannte
Fussschicht nicht.
(Bezeichnung der Zellwände nach deren Färbungseigenschaft.)
( Ectexine; siehe auch Nexine)
Ectexine; siehe auch Nexine)
|
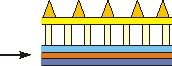
|
|
Endospor:
Die innerste Schicht der Sporenwand. Eventuell ist diese homolog
mit der Intine der Pollenkörner.
( Exospor; Perispor)
Exospor; Perispor)
|
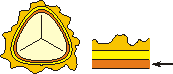
|
|
Exine (pl. Exines):
Die äussere Schicht der Pollenzellwand. Sie ist vor allem aus
Sporopollenin aufgebaut und deshalb äusserst resistent gegen
starke Säuren und Laugen.
( Intine)
Intine)
|
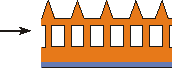
|
|
Exospor:
Die äussere Schicht der Sporenwand. Eventuell ist diese homolog
mit der Exine der Pollenkörner.
( Endospor; Perispor)
Endospor; Perispor)
|
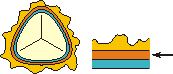
|
|
Fenestrat (adj.):
Eine Pollenklasse, welche durch grosse fensterartige Räume, denen
ein Tectum fehlt, charakterisiert ist.
|

|
|
Foveolae (= kleine Gruben; sing.
Foveola):
Runde Vertiefungen oder Löcher im Tectum,
welche mehr als 1 Mikrometer breit sind. Dabei ist der Abstand zwischen
zwei F. stets grösser als deren Breite.
|
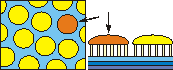
|
|
Foveolat (adj.):
Mit Foveolae.
|
 top
top
|
|
Frustillae (= abgebrochene
kleine Stücke; sing. Frustilla):
Synonym Areolae: (= kleine freie Plätze;
sing. Areola):
Kleine Fläche des Tectums, welches zwei oder
mehrere Columellae bedeckt.
|
|
|
Frustillat (adj.):
Mit Frustillae. (Synonym: Areolae)
|
|
|
Fussschicht (engl. footlayer):
Die innere Schicht der Ectexine.
|
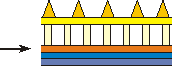
|
|
Gemma (= Knospe; pl. Gemmae):
Ein Element der Exine, das an seiner Basis
verengt, mindestens 1 Mikrometer hoch und etwa gleich breit wie
hoch ist.
|
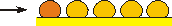
|
|
Gemmat (adj.):
Mit Gemmae.
|
|
|
Haploxylon-Typ:
Bisaccate (vesiculate) Pollen, bei denen
die Luftsäcke gegenüber dem Mittelteil nicht eingeschnürt sind.
(e.g. Pinus cembra, Picea)
( Diploxylon-Typ)
Diploxylon-Typ)
|
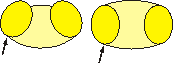
|
|
Heterocolpat (adj.)
Pollenkörner mit einfachen Colpi und zusammengesetzten
Aperturen.
|
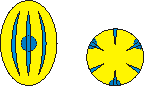
|
|
Homologie, homolog:
Ähnlichkeit von Organen, Merkmalen und Verhaltensweisen verschiedener
Arten von Lebewesen aufgrund gleicher entwicklungsgeschichtlicher
Herkunft (Evolution). Die Homologie wird der Analogie
gegenübergestellt.
( Analogie)
Analogie)
|
 top
top
|
|
Inaperturat (adj.):
Pollen oder Spore ohne Aperturen, eher selten.
(Bsp. Juniperus, Larix, Carex)
|
|
|
Intectat (adj.):
Pollen ohne Tectum, aber mit einer ausgestalteten
Exinenoberfläche (Skulptur).
( Struktur; Tectum;
Semitectum)
Struktur; Tectum;
Semitectum)
|
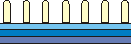
|
|
Intine:
Die innerste der Hauptschichten einer Pollenzellwand. Sie liegt
unterhalb der Exine und grenzt das Cytoplasma
ab. Die I. ist hauptsächlich aus Cellulose und Pektin aufgebaut
und deshalb nicht Acetolyse-resistent. Aus diesem Grund ist die
I. nach der üblichen Aufbereitung bei der Pollenbestimmung nicht
sichtbar.
( Exine)
Exine)
|
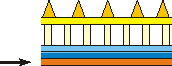
|
|
Isodiametrische Tetrade:
Eine allgemeine Bezeichnung für Tetraden,
in welchen alle Bestandteile ungefähr dieselbe Grösse aufweisen.
( Tetrade; Dyade)
Tetrade; Dyade)
|
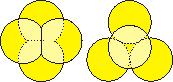
|
|
Konkordantes Muster:
Ein Muster in einem tectaten Pollenkorn,
in welchem die Columellae gleich angeordnet
sind wie die Elemente auf dem Tectum.
( Diskordantes Muster)
Diskordantes Muster)
|
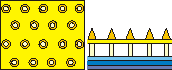
|
|
Lacuna (= Loch, Vertiefung, kleine
Grube; pl. Lacunae):
Mehr oder weniger runde Senke oder Öffnung in der Ectexine,
aber keine vollständige Pore.
|
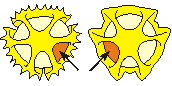
|
|
LO-Analyse:
Eine Methode zur Bestimmung von Mustern der Exine
mithilfe des Lichtmikroskops. Durch sorgfältiges Fokussieren durch
die Strukturen der Pollenoberfläche kann man sich ein dreidimensionales
Bild der Muster machen. Bei hohem Fokus erscheinen die erhöhten
Elemente hell (L=Lux; Licht), während die Löcher im
Tectum relativ dunkel erscheinen (O=Obscuritas; Dunkelheit).
Bei tiefem Fokus werden die Löcher dann als hellere Flächen ersichtlich
als die erhöhten Elemente, welche nun dunkel erscheinen.
( OL-Muster)
OL-Muster)
|
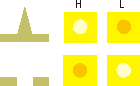
|
|
Luftsack:
Die relativ grossen Pollenkörner vieler Koniferen (beispielsweise
Pinus, Picea. Abies) vermindern ihre Sinkgeschwindigkeit
in der Luft durch "Luftsäcke". Diese kommen dadurch zustande, dass
sich die beiden äusseren Schichten der Exine
an zwei Stellen blasenförmig abheben.
( bisaccate Pollen
bisaccate Pollen
|

|
|
Lumen (= Fenster; pl. Lumina):
Lücke oder Raum zwischen den Wänden (Muri)
einer reticulaten, striaten
oder rugulaten Oberfläche eines Pollens.
( Murus)
Murus)
|
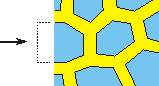
|
|
Margo (= Rand; pl. Margines):
Bezeichnet eine verdünnte oder verdickte Fläche der Exine
um einen Colpus herum.
( Anulus)
Anulus)
|
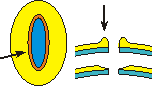
|
|
Meridional:
Meridional bedeutet von Pol zu Pol ("von Nord nach Süd") verlaufend,
im Gegensatz zu äquatorial.
( Polyplicat)
Polyplicat)
|
 top
top
|
|
Mikroreticulat (adj.):
Mit Mikroreticulum.
|
|
|
Mikroreticulum (=sehr feines
Netz; pl. Mikroreticula):
Netzartige (reticulate) Oberfläche des
Pollens, welche aus Muri und
Lumina (kleiner als 1 Mikrometer) besteht.
( Reticulum)
Reticulum)
|
|
|
Mikrosporen:
In der Palynologie allgemeiner Begriff für mikroskopisch kleine
Verbreitungseinheiten (Pollen und Sporen),
welche nur mithilfe einer starken Vergrösserung (Lichtmikroskop)
analysiert werden können.
( Pollen, Sporen)
Pollen, Sporen) |
|
|
Monocolpat, monoporat
(adj.):
Beschreibt Pollenkörner, welche einen Colpus,
oder einen Porus aufweisen.
|
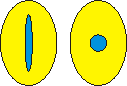
|
|
Monolet (adj.):
Spore mit einer einzelnen spaltförmigen Öffnung (kein Colpus).
( Trilet)
Trilet)
|
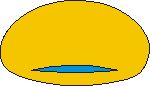
|
|
Murus (= Wand; pl. Muri):
Bezeichnet die Wand, welche bei einer reticulaten,
striaten oder rugulaten
Oberfläche eines Pollens zwei Lumina voneinander
trennt.
( Lumen)
Lumen)
|
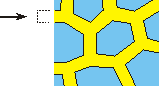
|
|
Nexine:
Der innere, nicht ausgestaltete Teil der Exine,
welcher unterhalb der Sexine gelegen ist.
Die N. beinhaltet im Gegensatz zur Endexine
auch die sogenannte Fussschicht.
( Sexine; siehe auch Endexine)
Sexine; siehe auch Endexine)
|
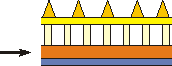
|
|
OL-Muster:
Muster auf der Pollenoberfläche, das bei hohem Fokus im Lichtmikroskop
die erhöhten Elemente dunkel und die Löcher hell und bei tiefem
Fokus gerade umgekehrt wiedergibt.
( LO-Analyse)
LO-Analyse)
|
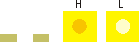
|
|
Operculum (= Deckel; pl. Opercula):
Dicke Membran, die einen Porus oder
Colpus zudeckt. Normalerweise ist der Deckel am Rand sehr dünn,
so dass das O. oft verloren gegangen ist (e.g. Plantago lanceolata-Typ).
|
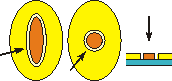
|
|
Palynologie:
Die Wissenschaft, die sich mit der Untersuchung fossiler und subfossiler
Pollen und Sporen in Böden und Sedimenten befasst; wichtige Methode
der relativen Altersbestimmung und zur Rekonstruktion der Vegetations-
und Klimageschichte.
|
 top
top
|
|
Peri- (-colpat, -colporat, -porat):
Elemente (Öffnungen), die gleichmässig über die gesamte Oberfläche
des Pollens verteilt sind.
( Stephano-)
Stephano-)
|
|
|
Perispor:
Ein Teil der Zellwand, welcher das Exospor
vieler Sporen umgibt. Sie ist nicht immer Acetolyse- resistent.
( Exospor, Endospor)
Exospor, Endospor)
|
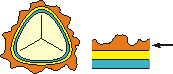
|
|
Plica (plicare = falten; pl. Plicae):
Rippenartige Falten auf der Pollenexine; kommt
selten vor.
( Polyplicat)
Polyplicat)
|
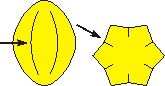
|
|
Polansicht:
Die Ansicht eines Pollens oder einer Spore, bei welcher die Polebene
gegen den Beobachter gerichtet ist.
( Äquatoransicht)
Äquatoransicht)
|
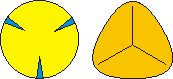
|
|
Pollen, Pollenkorn:
Die in den Staubblättern der Blütenpflanzen (Spermatophyten) enthaltenen,
mikroskopisch kleinen, männlichen Verbreitungseinheiten ("Körner"),
aus denen die männlichen Geschlechtskerne hervorgehen. Als Gesamtheit
werden die Pollenkörner als Pollen oder Blütenstaub bezeichnet.
Umgangssprachlich wird der Ausdruck Pollen jedoch meistens im Sinne
von Pollenkorn verwendet.
( Mikrosporen, Sporen)
Mikrosporen, Sporen) |
|
|
Pollentyp:
Eine morphologische Pollenkategorie, die Pollenkörner beinhaltet,
welche sich in einem Merkmal oder in einer bestimmten Kombination
von Merkmalen unterscheiden.
|
 top
top
|
|
Polyplicat (adj.):
Seltene Pollenkörner mit mehr als drei meridional verlaufenden
Plicae (e.g. Ephedra).
( Plica, meridional)
Plica, meridional)
|
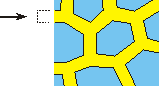
|
|
Porat (adj.):
Pollenkorn mit einem oder mehreren Pori.
|
|
|
Porus (gr. poros = Öffnung; pl. Pori):
Allgemeine Bezeichnung in der Palynologie
für eine Öffnung in der Exine eines Pollens,
welche meist eine rundliche Form und, falls etwas langgezogen, gerundete
Enden hat.
|

|
|
Probenaufbereitung:
Da das Aufspüren von Mikrosporen im Sediment oder Torf ohne vorherige
Behandlung äusserst zeitraubend wäre, wurden Verfahren zur Anreicherung
entwickelt. Diese machen sich vor allem die grosse chemische Resistenz
des Sporopollenins zunutze. Kalziumkarbonat kann durch HCl, Huminsäure
durch KOH, mineralisches Material durch HF, Zellulose durch Acetolyse
(Essigsäure-Anhydrid und konz. Schwefelsäure), grobes Material durch
Absieben durch ein feines Sieb entfernt werden.
( Acetolyse-Resistenz)
Acetolyse-Resistenz)
|
|
|
Psilat (adj.):
Pollen oder Spore mit glatter Oberfläche.
|
|
|
Reticulat (adj.):
Mit Reticulum.
|
 top
top
|
|
Reticulum (= feines Netz; pl. Reticula):
Ein netzartiges Muster der Exine, bestehend
aus Lumina (breiter als 1 Mikrometer) und
sie begrenzende Muri.
( Mikroreticulum)
Mikroreticulum)
|

|
|
Rugulae (= kleine Falte; sing. Rugula):
Langgezogene (länger als 1 Mikrometer) ungleichmässig angeordnete
Elemente der Exine. Das Muster liegt zwischen
striat und reticulat.
|
|
|
Rugulat (adj.):
Mit Rugulae.
|
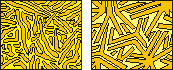
|
|
Saccat / Bisaccat (adj.):
Synonym: vesiculat:
Pollen, die (ein oder) zwei Luftsäcke enthalten. Diese Luftsäcke
dienen der besseren Verbreitung durch den Wind. (e.g. Pinus, Picea,
Abies)
|
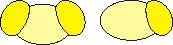
|
|
Scabrae (scaber = rau; sing. Scabra):
Elemente der Exine, die kleiner als 1 Mikrometer
in allen Richtungen sind und irgendeine Form aufweisen können.
|
|
|
Scabrat (adj.):
Mit Scabrae.
|
|
|
Semitectum:
Ein teilweise unterbrochenes Tectum, in welchem
die Löcher mindestens so breit sind wie die Muri
und einen Durchmesser von über einem Mikrometer aufweisen.
( Struktur; Tectum;
Intectat)
Struktur; Tectum;
Intectat)
|
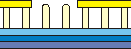
|
|
Sexine:
Die äussere, ausgestaltete Schicht der Exine,
welche auf der Nexine liegt. Die S. beinhaltet
im Gegensatz zur Ectexine die
Fussschicht nicht.
( Nexine; siehe auch Ectexine)
Nexine; siehe auch Ectexine)
|
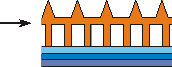
|
|
Skulptur:
Ausgestaltung der Exinenoberfläche von Pollen
und Sporen. Diese kann psilat, foveolat,
echinat usw. sein.
( Struktur)
Struktur)
|
 top
top
|
|
Spore (griech. sporos = aussähen):
In
der Palynologie sind damit die einzelligen,
mikroskopisch kleinen Keime der Farnpflanzen (Pteridophyten) und
Moose (Bryophyten) gemeint. Da sie, wie die Pollen,
eine sehr resistente Zellwand aus Sporopollenin
besitzen, bleiben die S. in den aufbereiteten Pollenpräparaten ebenfalls
erhalten.
( Mikrosporen, Pollen)
Mikrosporen, Pollen)
|
|
|
Sporoderm:
Die gesamte Zellwand eines Pollens oder Sporens.
|
|
|
Sporopollenin:
Acetolyse-resistentes Biopolymer, aus welchem der grösste Teil
der Exine aufgebaut ist.
|
|
|
Stephano- (-colpat, -colporat, -porat):
Mehr als drei Elemente (Öffnungen), die gleichmässig am Rande (Polansicht)
bzw. am Äquator (Äquatoransicht)
des Pollens angeordnet sind.
( Peri-)
Peri-)
|
 top
top
|
|
Striae (= Rinnen; sing. Stria):
Rinnenförmige Vertiefungen zwischen länglichen Elementen der Exine,
welche nahezu parallel zueinander angeordnet sind. Dieser Ausdruck
wird jedoch nur als Adjektiv (striat) benutzt,
das Substantiv ist nicht gebräuchlich.
|
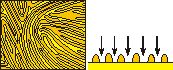
|
|
Striat (adj.):
Mit Striae. Muster der Exine,
bei welchem die "Muri" und die "Lumina",
hier Striae, nahezu parallel zueinander angeordnet
sind.
|
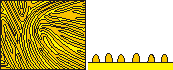
|
|
Struktur:
Der innere Bau der Exine von Pollen und Sporen.
Die S. kann tectat, intectat
oder semitectat sein.
( Skulptur)
Skulptur)
|
|
|
Syncolp (or)at (adj.):
Pollen, bei welchen zwei oder mehrere Colpi
oder zusammengesetzte Aperturen normalerweise
an den Enden miteinander verschmolzen sind.
|
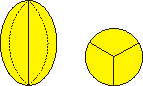
|
|
Tectat (adj.):
Mit Tectum.
|
|
|
Tectum (= Dach; pl. Tecta):
Diejenige Schicht der Sexine, welche ein
Dach über den Columellae bildet. Das
T. ist somit die äusserste Schicht der Zellwand eines Pollens. Es
kann mehr oder weniger vollständig ausgebildet sein.
( Struktur; Semitectum;
Intectat)
Struktur; Semitectum;
Intectat)
|
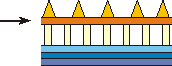
|
|
Tetrade:
Allgemeine Bezeichnung für eine Gruppe von vier verbundenen Pollenkörnern
oder Sporen, entweder während der Entwicklung oder als Verbreitungseinheit
(falls keine Trennung nach der Meiose stattgefunden hat). Die vier
Teile der T. können in einer Ebene oder aber im rechten Winkel zueinander
angeordnet sein.
( Isodiametrische Tetrade; Dyade)
Isodiametrische Tetrade; Dyade)
|
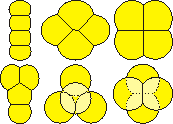
|
|
Tricolpat, tricolporat,
triporat (adj.):
Beschreibt Pollenkörner, welche drei Colpi,
drei zusammengesetzte Aperturen oder drei
Pori aufweisen.
|
 top
top
|
|
Trilet (adj.):
Spore mit drei spaltförmigen Öffnungen (keine
Colpi), die zu einem Y geformt sind ("Mercedesstern").
( Monolet)
Monolet)
|
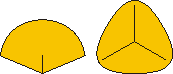
|
|
Verruca (= Warze; pl. Verrucae):
Ein Element der Exine, welches mindestens
1 Mikrometer breit ist und eine warzenförmige Gestalt aufweist.
Das heisst, es ist breiter als lang, am oberen Ende abgerundet und
an der Basis nicht eingeschnürt.
|
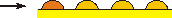
|
|
Verrucat (adj.):
Mit Verrucae.
|
|
|
Vestibulum (= Vorhalle, Eingang;
pl. Vestibula):
Loch, welches sich durch eine Trennung der zwei Schichten der Exine
um eine Pore herum gebildet hat. (e.g. Betula, Alnus)
|
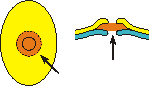
|